Lesezeit: ca. 3-4 Minuten – Wörter: 1.045
Wenn ich mit einer neuen Klasse im Fach Wirtschaft und Gesellschaft starte – so heißt der Politik- und Gesellschaftsunterricht an den Beruflichen Schulen in Hamburg – greife ich gerne auf die Methode „My First Political Memory“ zurück.
Diese Methode habe ich gleich zu Beginn meiner Ausbildung durch meine damalige Mentorin gezeigt bekommen. Hierdurch erhalte ich nicht nur einen Eindruck davon, wer vor mir sitzt, sondern auch, was Politik für die Lernenden eigentlich bedeutet. Denn: Politik ist immer schon Teil ihrer Lebenswelt – auch wenn sie das oft gar nicht bewusst wahrnehmen.
die Methode
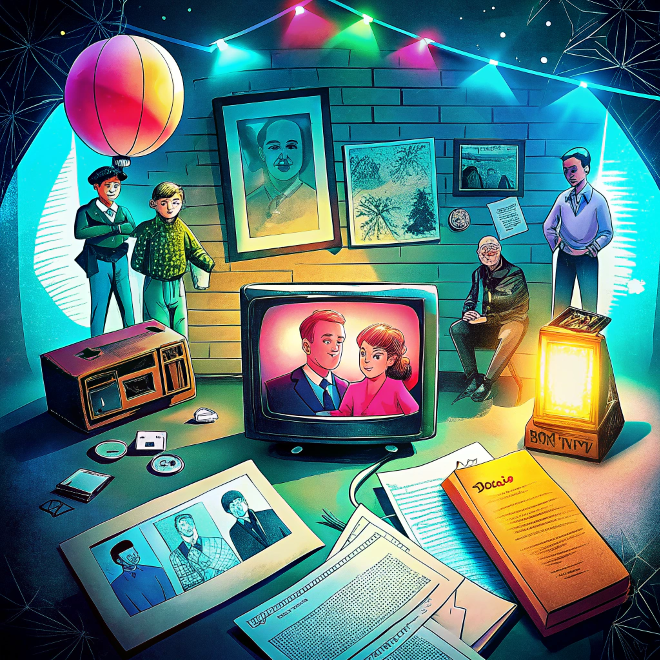
Die Methode ist simpel, aber wirkungsvoll: Schüler:innen erinnern sich an ihre erste politische Erfahrung. Das kann ein Gespräch zu Hause, eine Wahl im Fernsehen, ein Protest auf der Straße oder eine Nachricht in den Medien gewesen sein. Sie schreiben oder malen diese Erinnerung auf und tauschen sich anschließend in der Klasse darüber aus. So entsteht schnell ein buntes Bild davon, wie vielfältig Politik erlebt und gedeutet werden kann.
Noch bunter wurde es i.d.R. dank des Hinweises meiner damaligen Mentorin, dass man den Lernenden die Aufgabe auch als „Mal- bzw. Zeichenaufgabe“ geben könnte. Für (fast) erwachsene Schülerinnen und Schüler ist dieser Einstieg zwar befremdlich, lockert die erste Stunde allerdings auch extrem auf, wenn erstmal deutlich wird, dass es keine Extrapunkte für die Schönheit der einzelnen Bilder zu vergeben gibt.
Kennen sich die Lernenden einer Klasse ebenfalls selbst noch nicht so gut untereinander, dann bietet sich zudem eine Gruppenarbeit an einem großen Blatt Papier an, sodass ein Austausch innerhalb der Lerngruppe bereits beim Erstellen der einzelnen Erinnerungsbilder zustande kommt.
meine Anpassung bzw. Erweiterung der Methode

In der Praxis habe ich regelmäßig gemerkt: Sobald eine ganze Klasse ins Malen und Erzählen kommt, sprengt das leicht den vorgesehenen Rahmen von 90 Minuten, wen alle Bilder tiefgehend ausgewertet und besprochen werden wollen. Zudem gibt es immer eine nicht unerhebliche Zahl an Lernenden, die sich mit diesem offenen Impuls oftmals sehr schwer tun, weil sie für sich gar nicht erfassen, was alles eine politische Dimension haben könnte.
Deshalb habe ich mich dazu entschieden, für den Start des kommenden Schuljahres die Methode weiter zu entwickeln. Statt ausschließlich kreativ zu arbeiten, habe ich die Methode so angepasst, dass die Lernenden nun stärker auf schriftliche Reflexionen zurückgreifen. Außerdem habe ich die Sequenz gelenkter aufgebaut. Mir war wichtig, die verschiedenen Dimensionen von Politik aufzuzeigen – also nicht nur das Offensichtliche (z. B. Wahlen), sondern auch die institutionellen, gesellschaftlichen und persönlichen Ebenen.
Bei der Erstellung des Materials habe ich bewusst einige Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Statt ausschließlich auf die kreative Malaufgabe zu setzen, habe ich Leitfragen entwickelt, die stärker auf die persönlichen Erfahrungen mit Politik und dem Unterrichtsfach zielen. Diese Fragen helfen, den Einstieg strukturierter zu gestalten und machen sichtbar, wie Lernende ihre ersten bewussten politischen Erlebnisse, ihre bisherigen Erfahrungen im Unterricht und ihre eigene Haltung zum Fach beschreiben. Damit wollte ich den offenen Charakter der Ursprungsidee erhalten, aber gleichzeitig für mehr Verbindlichkeit sorgen.
Ergänzt habe ich außerdem Fallbeispiele, die in 2er-Teams bearbeitet werden. Sie führen die Jugendlichen in konkrete, alltagsnahe Situationen, in denen politische Dimensionen sichtbar werden.
das Material
Das dazu entwickelte Material für eine Diagnoseeinheit (60 Minuten) ist bewusst klar strukturiert und in mehrere Phasen unterteilt. Zunächst erhalten die Lernenden einen kurzen Impuls, der sie auf das Thema Politik im Alltag einstimmt. Anschließend bearbeiten sie Leitfragen zur persönlichen Wahrnehmung von Politik und ihrer persönlichen Erfahrung mit dem Politikunterricht in ihrer bisherigen Schule. Zudem wird die Ursprungsfrage, der „first political memory“ mit aufgegriffen, in der sie überlegen, welche Ereignisse sie bewusst miterlebt haben oder welche Themen ihnen in den Medien begegnen.
In einer darauf anschließenden Phase
bearbeiten die Lernenden in 2er-Teams Fallbeispiele aus drei unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten:
Politik im Alltag (z. B. Nutzung eines Sportplatzes, Handyregeln, höhere Nahverkehrspreise),
Institutionelle Politik (z. B. Bau einer Umgehungsstraße, Gesetz zur Plastikvermeidung, EU-Regeln zu TikTok) und
Partizipation (z. B. Schülervertretung fordert Mitspracherecht, Bürgerinitiative gegen ein Bauprojekt, Fridays-for-Future-Demo).
Zu jedem Fall bearbeiten sie die Leitfragen:
- „Was hat das mit Politik zu tun?“,
- „Welche Personen, Gruppen oder Institutionen sind hier beteiligt bzw. haben ein Interesse?“ und
- „Welche Handlungsmöglichkeiten gäbe es?“.
Ziel ist, dass die Jugendlichen erkennen: Politik betrifft nicht nur Parlamente oder Wahlen, sondern auch konkrete Fragen des Zusammenlebens. Die Beispiele verdeutlichen, wie breit Politik gefasst werden kann – von der persönlichen Ebene über Schule und Stadt bis hin zu nationalen und internationalen Entscheidungen.
Lehrkräfte erhalten somit ein mehrschichtiges Diagnosetool, das sowohl individuelle Erfahrungen als auch übergreifende Kompetenzen sichtbar macht. Damit wird die Diagnose selbst schon zum Einstiegsgespräch über Politik – nicht abstrakt, sondern unmittelbar an der Lebensrealität der Schüler:innen orientiert.
Fazit
Die Methode „My First Political Memory“ hat sich für mich als wertvoller Einstieg in den Politikunterricht erwiesen, weil sie die Jugendlichen bei ihren eigenen Erfahrungen abholt und Politik unmittelbar mit ihrer Lebenswelt verknüpft. Gerade durch den persönlichen Zugang entsteht schnell eine Offenheit, die den Beginn des Faches erleichtert und auch innerhalb der Klasse für Austausch sorgt.
Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die ursprüngliche Form – vor allem als kreative Malaufgabe – schnell an Grenzen stößt: Sie kostet viel Zeit und überfordert manche Lernende. Deshalb habe ich die Methode weiterentwickelt und durch klar strukturierte Leitfragen sowie Fallbeispiele ergänzt. Die Leitfragen helfen, persönliche Erinnerungen, Haltungen und Erwartungen sichtbar zu machen. Die Fallbeispiele wiederum sollen den Blick auf konkrete Situationen aus Alltag eröffnen, Institutionen und Partizipation und machen so deutlich, wie breit Politik gefasst werden kann.
Das neue Material verbindet damit das Persönliche mit dem Strukturierten: Es ermöglicht Diagnose und Austausch zugleich, ohne die Lernenden zu überfordern. Für mich ist es ein gelungener Kompromiss zwischen Offenheit und Orientierung – und ein guter Ausgangspunkt, um Politikunterricht von Anfang an lebensnah, verständlich und motivierend zu gestalten.

MATERIAL
Über diesen Button könnt ihr das OER-Unterrichtsmaterial (PDF) herunterladen.
Disskusionsanstoß
- Welche Vorteile bzw. Nachteile seht ihr darin, den Politikunterricht mit persönlichen Erinnerungen der Lernenden zu beginnen?
- Wie bewertet Ihr dieses Material? Gebt uns gerne euer persönliches Feedback dazu?
- Welche weiteren Methoden kennt ihr, um die Vielfalt an Erfahrungen und Perspektiven der Lernenden im Politikunterricht sichtbar zu machen?




